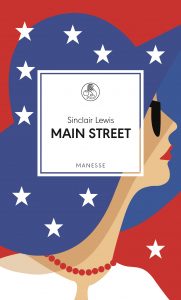An Selbstbewusstsein scheint es ihm nicht gemangelt zu haben. 1926 wurde Sinclair Lewis für seinen Roman Arrowsmith der Pulitzerpreis zuerkannt. Er aber lehnte ab, angeblich, weil der Titelheld eine für Amerika untypische Arztgestalt sei, wohl eher aber, weil er verärgert war, dass das Kuratorium eben dieses bedeutenden Preises die Jury überstimmte, die Lewis für den 1921 erschienenen Roman Main Street denselben Preis zuerkannt hatte. 1930 folgte dann die internationale Rechtfertigung. Als erster amerikanischer Schriftsteller erhielt er den Literaturnobelpreis, sicher zu Recht: Kaum ein anderer Schriftsteller hatte sich derart minutiös dem Alltagsleben des Durchschnittsbürgers gewidmet. In Babbitt schildert er einen mit dem Durchschnittsleben unzufriedenen Helden, in Main Street schickt er eine junge Frau in die Provinz, die dort das gesellschaftliche Leben revolutionieren will. Der Manesse Verlag hat den Klassiker jetzt neu herausgebracht.
Das Buchcover zeigt eine junge Frau mit Sonnenbrille und Hut, wie er vor hundert Jahren Mode war, eine mondäne junge Person – und das passt vorzüglich zur Heldin des Romans Carol Milford, zumindest so, wie sie die Bewohner des Provinzstädtchens Gopher Prairie sehen. Die junge Frau mit großen Idealen, die in Minneapolis ihre Ausbildung am College genossen hatte, folgte ihrem frisch angetrauten Mann, dem Arzt Will Kennicott, in seine Heimat, eine Stadt, die er ihr großartig als Inbegriff urbanen Lebens angepriesen hat, die sich jedoch der jungen Frau, die das wahre Großstadtleben kennengelernt hat, als Inbegriff provinziellen Miefs erscheint, auch wenn sich die junge Heldin zunächst großen Illusionen hingegeben hat und besten Willens war, die Stadt mit ihrer Hauptschlagader (in Wirklichkeit der einzigen) Main Street ebenso großartig zu finden, schließlich liebt sie ihren Mann, und der gehört als Arzt ja auch zur oberen Schicht dieser Stadt, in der gesellschaftliche Grenzen sehr genau gezogen sind. Diese Hautevolee von Gopher Prairie freilich sieht in der Ankömmlingin mit ihrer großstädtisch mondänen Kleidung und ihrem Hang, sogleich alles in neuem Stil umzukrempeln, einen Fremdkörper, den man respektieren muss, weil sie ja die Frau des Arztes ist, der man jedoch in keinster Weise auf ihrem Weg in eine neue urbane Zukunft des Städtchens folgen will. So erlebt der Leser den Einbürgerungsversuch der Heldin als qualvollen Leidensweg durch eine Provinzialität, die von den Bewohnern selbst freilich nicht als solche empfunden wird. Lewis gelingt es vorzüglich, die unterschiedlichen Positionen und Lebensanschauungen der Figuren plastisch werden zu lassen, den Versuch Cathys, sich einzugewöhnen, gepaart mit dem Wunsch, Gopher Prairie in eine neue Zukunft zu bringen – privat in der Neuausstattung von Wills Wohnhaus, öffentlich durch hochfliegende Pläne in Sachen Stadtarchitektur, Bildung und Kultur.
Und sie hat auch Erfolg. Den provinziellen Clubs der Stadt fügt sie alsbald einen Theaterverein hinzu, der freilich nicht die große Literatur spielen will, die ihr vorschwebt, sondern Triviales, das in dieser Stadt in jeder Beziehung favorisiert wird, sei es im Kino oder in der Leihbibliothek.
Lewis beschreibt eine Art weiblichen Don Quijote, der die Welt anders sieht, als sie ist, oder zumindest anders machen will, als sie zu bleiben gewillt ist – ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Dass Cathy am Ende ihren Mann verlässt, um in Washington ihr Glück zu versuchen, ist ein konsequenter Schritt – freilich ein Schritt, der nicht von Erfolg gekrönt ist, denn auch hier trifft sie auf Kleingeisterei, wenn auch verbrämt durch großstädtisches Gehabe.
Denn Lewis schreibt nur vordergründig eine Satire auf die Provinzstadt schlechthin, schließlich entstammte er selbst einer solchen, und die Vorzüge einer Kleinstadt gegenüber einer Metropole beschreibt Carols Ehemann Will sehr hellsichtig: „Dort habe ich das Gefühl, dass ich mitbestimmen kann. In einer Großstadt mit zwei-, dreihunderttausend Einwohnern dagegen, also da wär ich doch bloß eine weitere Laus im Pelz, eine von vielen Tausend.“
So werden die Bewohner von Gopher Prairie zwar vom Erzähler mit Ironie bedacht, aber mit durchaus wohlwollender, und auch Carol wird keineswegs als Heldin ohne Fehl und Tadel beschrieben. Schon als Studentin schwebte ihr ein Idealberuf nach dem anderen vor. Dort ist sie sich „noch nicht klar, was sie werden will, ob sie Jura studieren, Drehbücher schreiben, Krankenschwester werden, oder einen bislang unbekannten Helden heiraten wird.“
Lewis hat eine erzählerische Meisterleistung vollbracht, indem er beide Positionen als gleichberechtigt nebeneinander- oder auch gegeneinandersetzt. Mag der Roman auch vor hundert Jahren spielen, an Aktualität hat er nichts verloren, denn auch heute erlebt so mancher, den es nach dem Studium in Berlin, München oder Hamburg in ein Provinznest verschlägt, einen Kulturschock, von dem man sich gleichwohl auch erholen kann.
Am Ende kehrt Carol zu ihrem Mann zurück nach Gopher Prairie, desillusioniert, aber keineswegs verzagt. „Ich habe meine Niederlagen nie entschuldigt, indem ich mich über meine Ambitionen lustig gemacht habe oder so getan hätte, als wäre ich über sie hinaus gewachsen. Ich lasse nicht gelten, dass die Main Street so schön ist, wie sie sein sollte! Ich lasse nicht gelten, dass Geschirrspülen ausreicht, um eine Frau zufrieden zu stellen! Ich habe den Kampf für das Gute vielleicht nicht bis zum Ende ausgefochten, aber ich habe mir den Glauben daran bewahrt.“
Sinclair Lewis, Main Street, Manesse Verlag, Zürich 2018, 1008 Seiten, 28,00 Euro