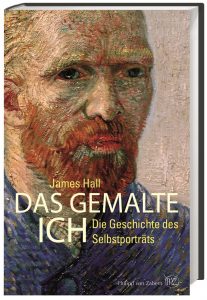Eine der schönsten und tiefgründigsten Geschichten zum Selbstbildnis findet sich in der griechischen Mythologie. Der schöne und auf seine Schönheit stolze Narziss weist alle Verehrerinnen ab, blickt eines Tages in eine Wasserquelle und verliebt sich unsterblich in sein Spiegelbild, ohne zu wissen, dass es sein eigenes Gesicht ist, das er sieht. Schließlich ist ausgerechnet das Gesicht, der Spiegel der Seele, aller Welt zugänglich, nur dem nicht, dem es gehört, zumindest nicht ohne Hilfsmittel. Kein Wunder, dass sich gerade Maler diesem Phänomen zugewandt haben, können sie doch sichtbar machen, was das Ich nicht zu sehen bekommt, allerdings im Lauf der Jahrhunderte aus unterschiedlichen Motiven heraus, wie James Hall in einer Studie nachweist: Das gemalte Gesicht.
Es gab Maler, deren Schaffen, zumindest phasenweise, geradezu manisch um das eigene Ich kreist. So malte sich Vincent van Gogh über zwanzig Mal. Es war für ihn ein Mittel der Selbstdarstellung, vielleicht auch der Selbsterkenntnis, denn die Fotografie war ihm zu diesem Zweck zu unvollkommen. Gemalte Selbstporträts kämen, so meinte er „wurzelecht aus der Seele des Malers“, das schaffe eine Maschine niemals. Und seine Selbstbildnisse halten stets auch Seelenzustände fest. Eines der frühesten von 1887 zeigt ihn hochkonzentriert an der Staffelei, ein späteres, wie er mit Kerzen auf dem Hut in der Nacht arbeitet, und schließlich sein berühmtestes, nachdem er sich in einer psychischen Krise ein Ohr abschnitt.
So weit ging der zweite Maler, der immer wieder sein eigenes Gesicht mit Pinsel und Farbe festhielt, nicht: Rembrandt, und doch sind auch seine Selbstbildnisse schonungslos. Da findet sich keinerlei Schönfärberei, jede Falte wird festgehalten, jedes Zeichen eines Altersverfalls offenbart.
Man sollte meinen, hinter Selbstbildnissen stecke fast zwangsläufig diese Leidenschaft für die Wahrheit, doch weit gefehlt. In der Renaissance dienten sie oft, den eigenen Selbstwert zu betonen. Dazu diente vor allem das jeweilige Umfeld, in dem sich die Künstler porträtierten. Solche Bilder zeigten den Maler nicht allein wie Rembrandt oder van Gogh, hier bewegen sich die Künstler auf den Bildern stets in hoher Gesellschaft, sie stellen sich als ebenbürtig mit den Herrschern und Reichen dar. Lorenzo Ghiberti gar, der die beiden Bronzetüren des Florentiner Baptisteriums schuf, fügte in beide ein Selbstporträt ein und mischt sich dabei unter Sibyllen und Propheten. Von da ist es nicht mehr weit zu dem Selbstbildnis, auf dem Albrecht Dürer sich darstellte, wie man es bis dahin nur auf Bildern von Jesus Christus fand. Auch Kirchen waren nicht frei von einer solchen egozentrischen Selbstdarstellung. Für die Zeit zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert hat man an derart ehrwürdigen Gebäuden nicht weniger als siebzig Selbstporträts identifizieren können, manche, wie das von Peter Parler am Prager Veitsdom, sogar in geradezu naturalistischer Ähnlichkeit.
Nicht viel später gefielen sich die Maler darin, sich zu heroisieren, entweder als Helden darzustellen oder als Kinder, denen die Zukunft noch offen steht. Und wie als Reaktion darauf entstand nur wenig danach die Mode, sich zu ironisieren, in aller Hässlichkeit darzustellen, gar als Ochsen. Vielschichtig wie stets ging Michelangelo in seinem Jüngsten Gericht vor. Da verlieh er der dem Hl. Bartholomäus abgezogenen Haut seine Gesichtszüge. Das könnte man als Selbsterhöhung deuten, denn der Maler stellt sich einem Heiligen gleich, doch sind seine Züge derart hässlich gezeichnet, dass darin zugleich auch Selbstironie oder -verleugnung gesehen werden kann.
Jede Epoche entwickelte, so Hall, ihre eigenen Methoden der Selbstdarstellung, und oft ist die Ähnlichkeit mit dem eigenen Gesicht gar nicht so wichtig. Selbstporträts haben stets eine Funktion – als Selbsterhöhung, als Selbstverspottung, aber natürlich auch als Selbstdarstellung in dem, was sie tagtäglich taten, als Maler im Atelier, an der Staffelei.
In der Regel setzen historische Darstellungen des Selbstbildnisses mit der Renaissance ein, jener Epoche also, in der der Mensch sich auf sich selbst besann. Hall beginnt seinen chronologischen Abriss mit einem Kapitel über Selbstbildnisse seit der Antike – von Bak, einem Baumeister von Pharao Echnaton, über Phidias, den bedeutenden Athener Bildhauer, von dem kein einziges Original erhalten geblieben ist, bis zu zahlreichen mittelalterlichen Selbstbildnissen in Handschriften, in denen nicht selten die Künstler sich ein Denkmal in den Verzierungen eines Buchstabens setzten.
Hall ist ein brillanter Stilist und Erzähler. Seine Hypothesen über die Funktionen des Selbstbildnisses leitet er aus anschaulichen, detaillierten Bildbeschreibungen her. Dabei kann man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht erkennen, doch lenkt er immer wieder auf seine Hauptaussagen zurück. Ein reines Lesevergnügen ist das Buch dennoch nicht, doch das liegt nicht am Autor, sondern am Verlag, der Anmerkungen und Register in derart kleinen Lettern gedruckt hat, dass man sie ohne Lupe kaum entziffern kann.
Für das 20. Jahrhundert schließlich konstatiert Hall ein allmähliches Verschwinden dessen, was ein Selbstbildnis ausmacht, des Gesichts. Künstler verhüllen es, James Ensor malte mit Vorliebe Masken, die das eigene Gesicht verdecken, Picasso stellte zwar gern den Künstler auf seinen Bildern, zumal den Zeichnungen, in den Vordergrund, doch mit seinem Kopf mit der markanten Glatze haben diese Darstellungen nichts zu tun. Ein solches Verschwinden ist in einem Zeitalter vielleicht auch kein Wunder, in dem ein Sigmund Freud neben das Ich ein Es gesetzt hat, in dem Soziologen das Ich in lauter Rollenspiele aufsplittern und ein Richard David Precht in seinem Erfolgsbuch die Frage stellt: „Wer bin ich – und wenn ja wie viele?“ Doch auch dieses Verschwinden des Körpers aus dem Selbstporträt gab es schon vor 1900. Noch einmal Vincent van Gogh! Er malte schlicht auf einem Bild lediglich den Stuhl, auf dem er regelmäßig saß. Auch das ist ein Selbstporträt.
James Hall, Das gemalte Ich. Eine Geschichte des Selbstporträts. Philipp von Zabern Verlag, 2016. 288 Seiten, 16,95