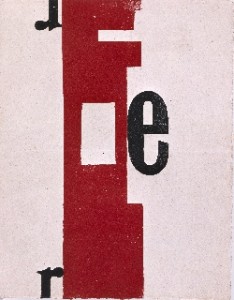„Quadratisch, praktisch, gut“ so lautet ein Werbespruch für eine berühmte Schokoladenmarke, die in Waldenbuch unweit von Stuttgart hergestellt wird. Das Unternehmen gehört den Geschwistern Alfred Ritter und Marli Hoppe-Ritter, und Letztere hat ein großes Hobby: Sie sammelt Kunst, die sie im eigens dafür erbauten Museum Ritter auch zeigt. Einziges formales Kriterium: Die Arbeiten müssen quadratisch sein. Jetzt zeigt sie in einer Ausstellung, dass sich quadratische – das heißt also vor allem abstrakte Kunst – nicht nur mit Pinsel und Stift auf Papier und Leinwand realisieren lässt, sondern auch mit dem Phänomen Licht. „Lunapark 2000“ heißt die Ausstellung, denn seit dem Jahr 2000 sammelt Marli Hoppe Ritter eben auch Lichtkunst.